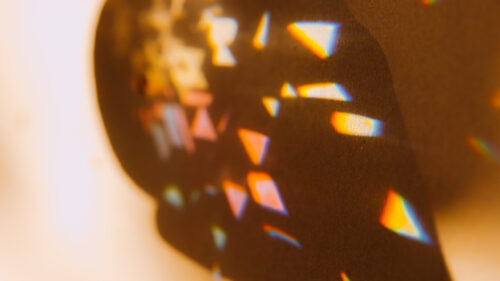Mitgemeint reicht nicht – Plädoyer für das Gendern juristischer Texte
Haben wir keine anderen Sorgen? Das ist eine gängige Reaktion auf Bemühungen, einen geschlechtersensiblen Gebrauch von Sprache und Text umzusetzen. Verdikte wie „Gender-Wahnsinn“ und „übertriebene political correctness“ sind dann schnell zu hören. Reformbemühungen verschwinden daher oft bald wieder in der Schublade. So ging es unlängst z.B. dem Vorhaben der Bundeswehr, weibliche Dienstgradbezeichnungen einzuführen.
Frauen sollen mitgemeint sein, Männer nicht
Ein ähnliches Schicksal erlitt im Oktober vergangen Jahres der Referentenentwurf des Justizministeriums zum Sanierungs- und Insolvenzrecht, der komplett in der weiblichen Begriffsform formuliert war. Statt männlichen Begriffsformen wie “Geschäftsführer”, “Verbraucher” oder “Schuldner” sollte durchweg das generische Femininum verwandt werden, also “Geschäftsführerin”, “Verbraucherin” und “Schuldnerin”. Das Bundesinnenministerium setzte sich dann allerdings durch mit dem Argument, es bestünde die Gefahr, dass das Gesetz dann nur für Frauen gelte und damit „höchstwahrscheinlich verfassungswidrig“ wäre. Das Argument kommt umgekehrt allerdings eher selten, wenn es um den Versuch der Rechtfertigung des generischen Maskulinums geht. Im Gegenteil, dann soll auf einmal allen klar sein, dass natürlich Frauen immer mitgemeint sind.
Immerhin gibt es allerdings bereits zahlreiche gesetzliche Vorschriften, die eine diskriminierungsfreie Rechtssprache in gesetzlichen Vorschriften fordern. Für Vertragstexte und allgemeine juristische Texte gilt eine solche gesetzliche Regel (mit ganz wenigen Ausnahmen) nicht. Wir Verfasser von Verträgen, Gutachten, Briefen und Schriftsätzen sind daher frei in der Entscheidung, ob wir Begriffe gendern oder nicht. Nicht wenige rufen dabei zur Zurückhaltung bei der Geschlechtsneutralisierung von Rechtstexten auf. Ins Feld geführt werden allerlei formale Argumente, die angeblich das Gendern mindestens ärgerlich und überflüssig machen sollen. So wird unter anderem rechtslinguistisch argumentiert, wonach in Wirklichkeit in den allermeisten Fällen das natürliche Geschlecht der bezeichneten Personen juristisch keine Rolle spiele. Werde dieses betont, sei das nicht nur überflüssig, sondern irrelevant und lenke sogar von der wesentlichen juristischen Aussage ab und drohe allgemein, auf Klarheit bedachte Texte unverständlich zu machen.
Verwendung männlicher Begriffe als self-fulfilling prophecy
Überzeugend ist das im Endeffekt nicht. Worte haben Konsequenzen. Sprache prägt das Denken. Dass Frauen in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft und in dem Gesellschafter*innen-Kreis deutscher Rechtsanwaltssozietäten unterrepräsentiert sind, hat vielfältige Ursachen. Vermutlich gehört auch das durch Sprache geprägte Framing tradierter Rollenverständnisse dazu. Die ausschließliche Verwendung der männlichen Sprachform hat in Wirklichkeit nicht das Mitdenken der Frauen zur Folge, sondern deren gedanklichen Ausschluss. In diesem Sinne wirkt die Verwendung männlicher Begriffe als self-fulfilling prophecy.
Gendern zwingt zur gedanklichen Abkehr von alten Strukturen
Das Gendern von juristischen Texten mag anstrengend sein, erforderlich ist es trotzdem. Wir sollten uns daher alle selbst zu einer möglichst geschlechtersensiblen Verwendung von Sprache verpflichten. Konkret bedeutet das die Verwendung von geschlechtsneutralen Personenbezeichnungen und, wo das nicht möglich ist, die Verwendung sowohl der weiblichen als auch der männlichen Form. Und, wenn alles nicht hilft, zur Not auch eines Sternchens. Erst wenn wir alle inklusive Formulierungen wie „Geschäftsführer*innen“, „Gesellschafter*innen“ und „Partner*innen“ verwenden, werden auch die letzten Traditionalisten Frauen in diesen Rollen wirklich mitdenken.
Dieser Beitrag ist die leicht geänderte Fassung der Kolumne des Autors im VC-Magazin 01/2021.