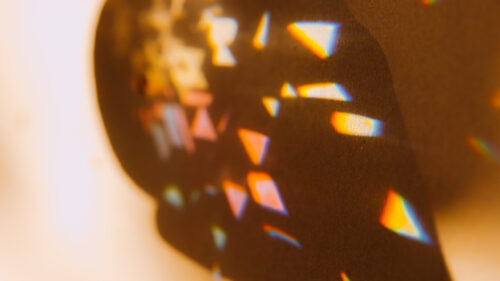Diese Sicht der Dinge ist gerade bekräftigt worden durch eine neue Entscheidung des OLG Köln vom 19. Juni 2020, in der das Smartlaw-Angebot des Wolters Kluwer-Verlages nicht als Rechtsdienstleistung angesehen wurde. Nach § 2 Abs. 1 RDG gilt als Rechtsdienstleistung nur eine Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, die eine rechtliche Prüfung des Einzelfalles erfordert. Aus Sicht des OLG Köln kann eine Software offenbar gar keine solche – nach dem RDG Rechtsanwälten vorbehaltene – Rechtsdienstleistung erbringen.
Digitaler Rechtsdokumente-Generator
Bei Smartlaw handelt es sich um einen digitalen Rechtsdokumente-Generator, bei dem auf der Grundlage eines Frage-und-Antwort-Systems aus einer Sammlung alternativer Textbausteine individuelle Rechtsdokumente erstellt werden. Um eine rechtliche Prüfung eines Einzelfalles handelt es sich dabei nach Ansicht des OLG Köln nicht. Das Gericht führt dazu aus: „Das Programm läuft – für den Anwender erkennbar – nach einer festgelegten Routine in einem Frage-/Antwortschema ab, mit dem ein Sachverhalt in ein vorgegebenes Raster eingefügt wird. Dies stellt unabhängig von der Anzahl der Fragen, der insoweit vom Programm geleisteten Hilfestellungen und der Individualität des schließlich erstellten Rechtsdokumentes keine Rechtsprüfung dar.“
Bloß schematische Rechtsanwendung keine Rechtsdienstleistung?
Das Urteil lehnt sich – dogmatisch natürlich durchaus vertretbar – eng an die Argumentation der Gesetzesbegründung zum RDG an. Im damaligen Regierungsentwurf des RDG war noch eine „besondere“ rechtliche Prüfung zur Voraussetzung der Rechtsdienstleistung gemacht worden. Das „besondere“ wurde dann zwar im weiteren Gesetzgebungsverfahren gestrichen, eine inhaltliche Änderung sollte damit aber nicht bezweckt werden. Entscheidend ist, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die rechtliche Prüfung über die „bloße Anwendung von Rechtsnormen auf einen Sachverhalt“ hinausgehen solle. „Bloße Rechtsanwendung“ wurde auf diese Weise zum Gegensatzpaar zu „juristischer Rechtsprüfung“, wobei letztere von einem „spezifisch juristischen Subsumtionsvorgang“ gekennzeichnet sei. Umkehrt sei eine bloß „schematische Anwendung des Rechts“ keine Rechtdienstleistung.
Damit ist dann auch für das OLG das Ergebnis der Entscheidung klar. Objektiv betrachtet kann das streitgegenständliche Programm nach Ansicht des OLG Köln mit seiner Führung durch einen Fragen-Antwort-Katalog nicht mehr leisten als eine rein schematische Anwendung von Rechtsnormen, auch wenn das mit dem Programm erstellte Dokument ein hohes Maß an Komplexität und Individualität aufweise. Die Software sei so programmiert, dass auf jede Handlungsanweisung eine vorbestimmte, standardisierte Antwort erfolge, so nutzerfreundlich das Programm auch ausgestaltet sein möge. Das bei der Anwendung des Programms ablaufende streng logische und zu immer den gleichen eindeutigen Ergebnissen führende Verfahren möge man als „Subsumtion“ werten können, ein rein logisch-schematisch ablaufender Übertragungsvorgang genüge nach den Gesetzesmaterialien gleichwohl nicht für die erforderliche objektive Rechtsprüfung im Rahmen eines Subsumtionsvorganges.
Einordnung unter festgefertigtes Schema als Kennzeichen jeder Subsumtion
Das überzeugt in der Sache heute so wenig wie zum Zeitpunkt des Inkrafttreten des Gesetzes. Natürlich ist jede softwaremäßige Rechtsanwendung schematisch in dem Sinne, dass sie einen Sachverhalt in ein fest gefertiges Schema einzuordnen versucht. Damit wäre Software – folgt man allein dem Willen des Gesetzgebers – vermutlich in der Tat niemals geeignet, Rechtsdienstleistung zu konstituieren. Bei näherer Betrachtung ist in Wirklichkeit aber die Einordnung eines Sachverhalts in ein fest gefertigtes Schema der Kern jeder juristischen Subsumtion. Und damit auch dessen, was Anwälte tagtäglich machen. Es geht bei der Subsumtion darum zu unterscheiden, ob alle Tatbestandsmerkmale einer Norm durch Angaben im Sachverhalt gedeckt sind. Das ist im Grundsatz ein einfaches logisches Schlussverfahren, bei dem eine Rechtsnorm (Obersatz) auf einen Sachverhalt (Untersatz) angewendet wird. Es führt daher in die Irre, wenn bereits die Gesetzesbegründung des RDG und dieser folgend das OLG Köln den rechtsanwaltlichen Subsumtionsvorgang zu einem Aliud gegenüber der bloß schematischen Rechtsanwendung hochstilisiert.
Zur Abgrenzung von juristischer Dienstleistung von anderen Tätigkeiten ist der Hinweis auf ein vorgefertigtes Schema denkbar ungeeignet. Anwaltliche Tätigkeit ist zu einem Großteil in diesem Sinne auch schematisch. Natürlich ist, je nach Fallgestaltung, Fragestellung, Qualifikation und Tagesform nicht jede Tätigkeit jedes Anwalts immer nur schematisch. Vielmehr sind Intuition, Judiz, Erfahrung, soziale und emotionale Kompetenz und Kreativität oftmals wesentlichere Faktoren, um einen guten von einem schlechten Anwalt zu unterscheiden als bloße Rechtskenntnis und Rechtsanwendungsfähigkeit. Notwendige Voraussetzungen anwaltlicher Tätigkeit sind sie jedoch nicht. Auch im juristischen Staatsexamen werden diese Kompetenzen nicht geprüft.
Keine Differenzierung zwischen “echter” und “unechter” Rechtsanwendung möglich
Es gibt deswegen, anders als das OLG Köln mit der Gesetzesbegründung meint, auch nicht Fälle von „echter Rechtsanwendung“ oder „substantieller Rechtsanwendung, die man von „unechter Rechtsanwendung“ abgrenzen könne. Zwar mag die Subsumtion eines Sachverhalts unter einen rechtlichen Obersatz unterschiedlich komplex sein. So ist die Frage, ob meine 17jährige Tochter einen Grundstückskaufvertrag wirksam schließen kann, möglicherweise leichter zu beantworten als die Frage, ob ein bestimmtes LegalTech-Geschäftsmodell nach dem RDG Anwälten vorbehalten ist oder auch von einem Startup von Studienabbrechern betrieben werden darf. Juristische Subsumtion erfordert beides, egal wie einfach oder schwer die Zuordnung des Sachverhalts zu einem juristischen Obersatz ist.
Auch weitere Aspekte, die das OLG in seiner Entscheidung heranzieht, sind in Wirklichkeit zur Abgrenzung von Rechtsdienstleistungen ungeeignet. So soll eine „festgelegte Routine in einem Frage-/Antwortschema“ wie die das Programm darstelle, keine Rechtsprüfung darstellen. Eine derartige „Einfügung eines Lebenssachverhaltes in ein vorgegebenes Raster“ und ein „rein schematischer Ja-Nein-Code“ ermögliche lediglich in der Sache „prüfneutrale Entscheidungen“, sei aber keine Rechtsdienstleistung. Auch insoweit gilt: Die Entwicklung derartiger differenzierender Ja-Nein-Kriterien ist gerade das Kennzeichen jeder Art von juristischer Subsumtion.
Die bittere Wahrheit für uns Anwälte ist: Unsere Tätigkeit besteht zwar nicht ausschließlich, aber zu einem nicht geringen Teil aus festgelegten Routinen und der Entwicklung von Frage- und Antwort-Schemata, mit denen Lebenssachverhalte unter vorgegebene Raster gefügt werden. Das ist genau der Grund, warum LegalTech für Anwälte disruptiven Charakter hat. Sie kann mindestens einen Teil der klassischen anwaltlichen Schreibtischtätigkeit ersetzen.
Je besser LegalTech-Angebote werden, desto klarer sind sie Rechtsdienstleistung
Die bittere Wahrheit für die Anbieter von LegalTech-Angeboten ist: Je besser diese werden, desto klarer wird auch Gerichten werden, dass es sich dabei sehr wohl um eine Tätigkeit handelt, die nach dem RDG Anwälten vorbehalten ist. Mittels Software kann in Wirklichkeit mancher Einzelfall sehr gut rechtlich bewertet werden. Und das in einer Weise, wie es die in dem der Entscheidung des OLG zugrunde liegenden Sachverhalt behauptet wurde, „günstiger und schneller als der Anwalt“. Und dann ist, wenn nicht der Gesetzgeber doch noch einschreitet, der Anwendungsbereich des RDG eröffnet. Und manches hoffnungsfrohe Startup raus.