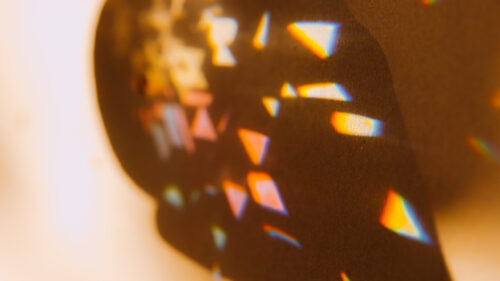Es ist zwar nicht das Gespenst des Kommunismus, doch erlebt Begriff der „Vergesellschaftung“ ein bemerkenswertes Comeback. Nachdem Sanierungssatzungen, Mietpreisbremsen, Vorkaufsrechte etc. den Anstieg der Mieten nicht oder nur unzureichend verhindern können, sollen in Berlin jetzt Wohnungen vergesellschaftet werden. Großen Wohnungsunternehmen soll auf diese Weise ein Teil ihrer Wohnung genommen werden, damit sie zu „fairen“ Preisen angeboten werden können. Politischen Nachdruck erhält diese Forderung durch ein entsprechendes Volksbegehren. Der Jurist reibt sich verwundert die Augen: Diese Forderung ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Vielmehr hat die Idee der Vergesellschaftung ihren Niederschlag im Grundgesetz gefunden.
Das Grundgesetz ermöglicht die Vergesellschaftung – aber auch die Berliner Verfassung?
Art. 15 Grundgesetz (GG) sieht vor, dass u.a. Grund und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden kann. Lässt man einmal die – nicht unwesentliche – Frage außen vor, ob Wohnungen bzw. Mietswohnhäuser noch als Teil von Grund und Boden zu sehen sind, so eröffnet sich pünktlich zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes juristisches „Neuland“. Denn in den letzten 70 Jahren kam Art. 15 GG nicht zur Anwendung. Folglich kann in dieser Angelegenheit bisher nicht oder nur in geringem Maß auf die Weisheit des Bundesverfassungsgerichts zugegriffen werden. Vielmehr muss sich hier jeder selbst seine Meinung bilden.
Dass diese Regelung allein durch Zeitablauf überholt ist, lässt sich in dieser Allgemeinheit kaum überzeugend vertreten. Verschiedene Regelungen im Grundgesetz sind bisher noch nicht zur Anwendung gekommen, weil die entsprechenden Situationen – glücklicherweise – noch nicht eingetreten sind. Allein aus diesem Grund lässt sich die fortdauernde Wirksamkeit dieser Regelungen nicht in Zweifel ziehen.
Eine andere Frage ist hingegen, ob auch die Berliner Verfassung eine Vergesellschaftung ermöglicht. Dort ist eine Vergesellschaftung nicht vorgesehen. Es lässt sich bereits mit guten Argumenten vertreten, dass das Eigentum in Berlin vor einer Vergesellschaftung geschützt ist. Denn die Landesverfassung böte insofern ein höheres Schutzniveau als das Grundgesetz und das Land Berlin müsste bei allem staatlichen Handeln dieses erhöhte Schutzniveau beachten.
Findet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Anwendung?
Wenn man diese Überlegung einmal bei Seite lässt und sich auf den viel zitierten Art. 15 GG konzentriert, lautet die entscheidende Frage, unter welchen Voraussetzungen Art. 15 GG anwendbar ist. Oder um es etwas präziser zu formulieren: Findet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei Art. 15 GG Anwendung? Diese Frage überrascht zunächst. Hat (oder sollte zumindest) doch jeder Jurist gelernt haben, dass staatliches Handeln dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen muss. Es muss einem legitimen Zweck dienen und zur Erreichung dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen sein. Gleichwohl erscheint die Literatur gespalten, ob bei Art. 15 GG dieser Grundsatz anwendbar sein soll.
Begründen lässt sich diese Uneinigkeit mit der besonderen Gestaltung des Art. 15 GG. Dort wird der legitime Zweck anscheinend bereits festgeschrieben. Denn die Überführung ins Gemeineigentum erfolgt „zum Zwecke der Vergesellschaftung“. Wenn man davon ausginge, dass die Vergesellschaftung somit der Zweck der Überführung von Eigentum ins Gemeineigentum – also letztlich Selbstzweck – ist, würde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz tatsächlich weitgehend obsolet. Denn für eine Vergesellschaftung wäre es nun mal in der gegenwärtigen Marktwirtschaft geeignet und erforderlich, Privateigentum ins Gemeinschaftseigentum zu überführen. Und auch die Angemessenheit ließe sich vielleicht bejahen, wenn man mit dem Bundesverfassungsgericht von einem weiten Spielraum des Gesetzgebers bei der Gestaltung der Wirtschaftsordnung ausgeht.
Vergesellschaftung kein Selbstzweck
Doch reicht die Vergesellschaftung bereits als Selbstzweck für die Begründung des Entzugs von Privateigentum wirklich aus? Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Privatisierung des Volkswagenwerks legt nahe, dass auch wirtschaftspolitische Entscheidungen stets am Gemeinwohl zu orientieren sind. In Art. 15 GG hat diese Voraussetzung – im Gegensatz zur Enteignung gemäß Art. 14 Abs. 3 GG – keinen ausdrücklichen Niederschlag gefunden. Sei es, weil der Gemeinwohlbezug in dem Begriff der Vergesellschaftung bereits enthalten ist, sei es, weil dieser Bezug im Jahr 1949 als ungewollte Beschränkung auf dem Weg zu einer sozialistischen Wirtschaftsordnung gesehen wurde.
Nachdem sich die (soziale) Marktwirtschaft über 70 Jahre als wirtschaftspolitische Grundausrichtung der Bundesrepublik verfestigt hat, erscheint eine Gleichsetzung von Vergesellschaftung und Gemeinwohl jedenfalls nicht mehr zeitgemäß. Selbst wenn man davon ausginge (was angesichts der Entstehungsgeschichte keineswegs eindeutig ist), dass bei Erlass des Grundgesetzes eine solche Gleichsetzung angenommen wurde, hätte insofern jedenfalls ein Auffassungswandel stattgefunden. Es ist heute kaum vorstellbar, dass der Entzug von Eigentum allein durch den (Selbst)Zweck der Vergesellschaftung ohne Rückgriff auf einen dahinterstehenden Gemeinwohlbelang gerechtfertigt werden kann. Sofern man darin überhaupt einen Verfassungswandel sehen will, sei darin erinnert, dass Bundestag und Bundesregierung in letzter Zeit auch in weniger eindeutigen Fällen einen solchen Wandel angenommen haben.
Auf den hinter der Vergesellschaftung stehenden Zweck kommt es an
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die Sicherung von bezahlbarem Wohnraum, die in Berlin hinter der angedachten Vergesellschaftung steht, ist ein Gemeinwohlbelang und kann damit ein legitimer Zweck von staatlichem Handeln sein. Wenn indes auf diesen eigentlichen Zweck abgestellt wird, ist daran auch die Verhältnismäßigkeitsprüfung auszurichten. Dann ist diese Prüfung nicht länger obsolet. Vielmehr stellt sich bereits die Frage, ob der Eigentumsentzug überhaupt erforderlich ist, weil andere gleich geeignete Mittel zur Verfügung stehen. Denn das dafür erforderliche Geld könnte auch in den Wohnungsneubau investiert werden, so dass der Wohnraummangel nicht nur verwaltet, sondern auch behoben wird.
Kosten entstehen in jedem Fall
Dass auch bei einer Vergesellschaftung wesentliche Kosten aufgrund der zu zahlenden Entschädigungen anfallen würden, steht dabei außer Frage. Zwar wird teilweise behauptet, dass bei einer Vergesellschaftung eher ein symbolischer Ablösepreis bezahlt werden müsste. Dabei handelt es sich jedoch um reines Wunschdenken, das keine Stütze in Art. 15 GG findet. Vielmehr wird dort auf die Entschädigungsvorschriften der Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG verwiesen. Die Höhe der Entschädigung ist unter Abwägung des öffentlichen und des privaten Interesses zu bestimmen. Spätestens an dieser Stelle würde der Staat somit unter Rechtfertigungsdruck geraten und das hinter der Vergesellschaftung stehende Interesse näher darlegen müssen. Es ist nicht erkennbar, dass das öffentliche Interesse – gerade in Anbetracht der möglichen Alternativen – derart überwiegt, dass die Betroffenen ihr Eigentum mehr oder weniger entschädigungslos aufopfern müssen.
Bezahlbaren Wohnraum auf andere Weise schaffen
Die gegenwärtige Diskussion zeigt, welches Ausmaß das Problem des knappen Wohnraums in Berlin angenommen hat. Der Handlungsbedarf ist unverkennbar. Jedoch bietet die „Wiederentdeckung“ des Art. 15 GG keine Lösung für dieses Problem. Es sollte lieber über andere geeignete Mittel nachgedacht werden